 |
5.
- 8. September 2002
|
 |
|
|
|
|
Eine Veranstaltung von
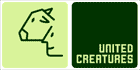
eine Initiative von

und

Site
Hosted by
![]()
|
Gerhard Marschütz: Theologische Elemente einer Tierethik 1 Einleitung Unsäglich ist das vielfältige Leid, das unzähligen Tieren durch Menschen widerfährt (Massennutztierhaltung, Tierversuche usw.). Die christliche Theologie scheint dem keine entsprechende Ethik entgegenstellen zu können. Müsste demnach der Titel meines Vortrages nicht mit einem Fragezeichen versehen werden? Zumindest aus der Perspektive der jüngeren, intensiv geführten moralphilosophischen Tierethik-Debatte und den damit in Verbindung stehenden zahlreichen Tierbefreiungs- und Tierrechtsbewegungen ist diese Frage wohl zu bejahen. Die Erwartung, dass von der christlichen Theologie hinreichend Elemente für eine Tierethik entfaltet werden könnten, tendiert hier gegen Null. Weithin wird sie zum einen vielfach gar nicht erst formuliert oder zum anderen durch kritische Gegenargumente als nicht zielführend entlarvt. Sogar innerhalb der Theologie wird von Eugen Drewermann die These vertreten, dass es kaum möglich sei, „auf dem Boden der Bibel eine umfassende, nicht nur auf den Menschen bezogene Ethik der Natur zu begründen“, denn hier werde eine Grundhaltung ausgeprägt, derzufolge „der Mensch eine absolute Vorrangstellung in der Natur besitzt und den Anspruch einer uneingeschränkten Machtausübung in der Natur erheben kann, ja soll“(Der tödliche Fortschritt, 100; 79) Auch wenn diese Auffassung so nicht haltbar ist, kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass die theologische Literatur zum Thema Tierethik „sehr arm“ (A. Bondolfi) ist und zudem oft nur als Teilgebiet einer Umweltethik abgehandelt wird. Allein an Zahl der Veröffentlichungen, so Gotthard M. Teutsch in der Zeitschrift ALTEX (1997), liegt die theologische Literatur gegenüber der Philosophie drastisch zurück. Verantwortlich hierfür sei vor allem, dass es der Theologie nur schwerlich gelingt, „die anthropozentrische Begrenzung zu überwinden“, der bekanntlich in wirkungsgeschichtlicher Perspektive eine starke Mitschuld am gewaltsamen Umgang mit der Tierwelt angelastet wird. Die weit verbreitete Kritik an dieser anthropozentrischen Begrenzung läuft im Kern darauf hinaus, dass hier nur Menschen ein moralischer Status zuerkannt werde, die nichtmenschliche Wirklichkeit und damit auch Tiere hingegen zu Objekten degradiert würden, mit denen der Mensch nahezu beliebig umgehen könne. Der zentrale Vorwurf gegen die Anthropozentrik artikuliert sich demnach im Speziesismus und besagt, dass die menschlichen Interessen prinzipiell Vorrang vor denen anderer Lebewesen haben und zwar einfach deswegen, weil - hinsichtlich unseres Themas - Menschen einer anderen Spezies (der Spezies homo sapiens) zugehören als Tiere. Die diesem Vorrang zugrunde liegende Differenz zwischen Mensch und Tier, wird von den meisten TierethikerInnen bestritten. Deren Ausgangsbasis ist in je unterschiedlicher Entfaltung die Gemeinsamkeit, ja Gleichheit von Mensch und Tier, die insbesondere in der - Menschen und Tieren gemeinsamen - Schmerz- und Leidensfähigkeit ihren zentralen und zugleich moralisch relevanten Reverenzpunkt findet. Moralischer Status kommt hier nicht nur Menschen, sondern auch Tieren, zumindest „höheren“ Tieren zu. Daher könne eine Tierethik nach Auffassung vieler TierethikerInnen nur im Rahmen eines pathozentrischen (d.h. alle schmerz- und leidensfähigen Lebewesen von vornherein einschließenden) Ansatzes entfaltet werden. Ein anthropozentrischer Ansatz hingegen könne systembedingt tierethische Anliegen nicht angemessen zur Geltung bringen. Will man also theologische Elemente für eine Tierethik zu entfalten, so kommt man nicht umhin, sich mit der Kritik an der Anthropozentrik und damit auch am Speziesismus auseinanderzusetzen. Dass eine solche Auseinandersetzung zu einem sinnvollen Ergebnis führen könnte, wird freilich von vielen bezweifelt – im Hinblick auf die in den biblischen Schöpfungsberichten überlieferte Sonderstellung des Menschen und den damit verbundenen sog. Herrschaftsauftrag (dominium terrae) „Unterwerft Euch die Erde“ (Gen 1,28). Dem Vorwurf, dass schöpfungstheologisch bereits alles gegen die Möglichkeit der Entfaltung einer angemessenen Tierethik vorentschieden sei, gilt es im Folgenden nachzugehen. Dabei setze ich voraus, das einzelne Bibelzitate nicht als Schlagworte für oder gegen eine bestimmte Auffassung herhalten können. Die Interpretation biblischer Texte erfordert komplexe Reflexionen, die durch vorschnelle, monokausale Schuldzuweisungen an eine Textstelle oder eine damit verbundene Tradition –die jüdisch-christliche – alsbald verunmöglicht werden. 2 Schöpfungstheologische Elemente Die grundlegenden Aussagen des christlichen Schöpfungsglaubens finden sich auf den ersten Seiten der Bibel, entfaltet insbesondere in zwei Schöpfungsgeschichten. Vorweg ist - um Mißverständnissen vorzubeugen - festzuhalten, dass darin keine Antwort gegeben werden will auf die Frage, wie die Wirklichkeit der Welt in raum-zeitlicher Abfolge entstanden ist. Schöpfung ist kein empirischer, sondern ein theologischer Begriff, der besagt, dass alle Wirklichkeit in Gott ihren Ursprung hat. Die biblischen Schöpfungsgeschichten bezeugen den Glauben, dass die Welt in Gott ihren Urgrund, Ursprung und ihr Endziel hat. Jede „Vorher-Nachher“ Interpretation auch im Sinne eines Nacheinanders von Paradies und Sündenfall ist somit nicht haltbar. Manche Theologen markieren Schöpfung sogar als eschatologischen, d.h. endzeitlichen Begriff, der primär nicht den Anfang, sondern diesen auf das Ende im Sinne der „Hoffnung auf ihre Erfüllung hin“ (U. Hediger), die Gott verheißt, in den Blick nimmt. Diese wenigen Vorbemerkungen verdeutlichen, dass es alles andere als leicht ist, die biblischen Schöpfungsaussagen angemessen zu interpretieren. Auf keinen Fall stellen sie Patentrezepte zur Verfügung, die unmittelbar für oder auch gegen eine bestimmte Tierethik herhalten könnten. Darauf komme ich später noch zurück. Es ist allerdings sinnvoll und möglich, (zumindest skizzenhaft) wichtige Elemente herauszustellen, die dem biblisch überlieferten Schöpfungsglauben zugrunde liegen. 1. Ein erstes Element besagt, dass alles sich Gott verdankt, in
ihm seinen Ursprung hat. Es verweist darauf, dass alles Geschaffene
vorgängig zu jeder Unterscheidung und Rangordnung als unhintergehbare
Einheit konzipiert ist und somit in fundamentaler kreatürlicher
Gemeinschaft zu sehen ist. 2. Ein zweites Element bezieht sich auf den Eigenwert alles Geschaffenen. 3. Diese kreatürliche Gemeinschaft, in der allem Geschaffenen
ein jeweiliges Eigensein zukommt, bildet den Hintergrund für
das dritte Element, die Betonung der Sonderstellung, die den Menschen
innerhalb der Schöpfung auszeichnet. Allein beim Menschen heißt
es „Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen“ (Gen
1,28a). Mit der Schaffung des Menschen als Abbild Gottes (und derart
zugleich als Höhepunkt der Schöpfung) wird jene qualitative
Differenz in der Gemeinschaft zwischen Mensch und Tier markiert,
derzufolge allein der Mensch zu einer besonderen Beziehung zu Gott
befähigt ist und in dieser Gottesbeziehung zugleich erst seine
Identität findet. Der zweite Schöpfungsbericht in Gen
2 und 3 bringt diese Differenz darin zum Ausdruck, dass allein der
Mensch dem Menschen ein adäquater Partner ist, nicht aber das
Tier. („Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von
meinem Fleisch ...“ vgl. Gen 2,19ff) 4. Ein viertes Element verweist darauf, dass der biblische Schöpfungsglaube
nicht nur auf den Anfang aller Wirklichkeit gerichtet ist, sondern
zugleich eine geschichtliche und endgeschichtliche Ausrichtung beinhaltet.
Schöpfung wird somit nicht nur als einmaliges Ereignis der
Vergangenheit verstanden, sondern als etwas, das in die Gegenwart
hinein dauert und in die Zukunft hinein ragt. Neben den hier skizzierten schöpfungstheologischen Elementen
gibt es freilich weitere biblische Fundorte, die das Mensch-Tier-Verhältnis
thematisieren. Für weitere Entfaltungen fehlt allerdings der
nötige Raum. Statt dessen zitiere ich daher einige Sätze
aus einem Artikel, der das menschliche Verhältnis zu den Tieren
in der Bibel ausführlich behandelt: In der Bibel werden Tiere weder vermenschlicht, noch verdinglicht. Als Gottes Geschöpfe besitzen sie einen eigenständigen Wert, den es zu achten gilt. 3 Theologische Elemente einer Tierethik Wenn hier nicht weitere biblische Belege für das Mensch-Tier-Verhältnis referiert werden können, so ist das insofern nicht tragisch, als diese sich weithin in die dargelegten schöpfungstheologischen Elemente einordnen lassen. Zudem besteht Konsens darüber, dass aus biblischen Aussagen nicht unmittelbar eine Ethik abgeleitet werden kann und somit sich im einzelnen keine Tierethik begründen lässt. Andernfalls könnte die Theologie zu vielen aktuellen und ethischen relevanten Konflikten des Mensch-Tier-Verhältnisses gar nicht Stellung nehmen, weil derartige Konflikte in der Bibel schlechterdings nicht auftauchen. Eine theologisch begründete Tierethik lässt sich nur in enger Anlehnung an und Auseinandersetzung mit philosophischen Theorien wie auch ethologischen Einsichten entwickeln. Was einzig und allein zählt, ist auch in einer theologisch begründeten Tierethik die vernünftige Argumentation und Begründung. Wozu bedarf es dann noch der Theologie, könnte man nun einwenden.
Allein die Tatsache, dass es z.B. verschiedene moralphilosophische
Theorien zur Tierethik gibt, zeigt, dass das rationale Argument
keineswegs eine gleichförmige Logik aufweist, sondern jeweils
von zugrunde liegenden Prämissen abhängig ist. Die Vernunft
operiert niemals im luftleeren Raum, sondern immer schon in je unterschiedlichen
Sinnzusammenhängen, die auch Prämissen bewirken (z.B.
Weltbilder, Menschenbilder), innerhalb derer die Vernunft argumentiert.
Sinngehalte bestimmen Denkinhalte. In theologischer Perspektive
ist es die vom Glauben erleuchtete Vernunft, oder anders gesagt:
Der Glaube gibt der Vernunft zu denken. Demnach gibt der Schöpfungsglaube
der Vernunft zu denken, er inspiriert Reflexionen in eine bestimmte
Richtung. Er wirkt hermeneutisch als Sinnhorizont ethischer Reflexionen. Ich beginne mit dem zweiten Element, dem kreatürlichen Eigenwert
alles Geschaffenen, der es verbietet, Tiere als bloße Gegenstände
menschlichen Handelns zu betrachten. Jenseits theologischer Prämissen
erfließt daraus die Aufgabe, in den Diskurs über den
moralischen Status von Tieren einzutreten. Es müßte theologisch
außer Frage stehen, dass auf viele Tiere zutrifft, dass sie
(hinsichtlich der von G.J. Warnock eingebrachten Unterscheidung
von “moral agents” und “moral patients“)
„moral patients“ sind, also Wesen, die der handelnde
Mensch um ihrer selbst willen in seinen moralischen Überlegungen
zu berücksichtigen hat; die also „Objekt der Sittlichkeit“
(G.J. Warnock) sind und denen gegenüber daher direkte moralische
Verpflichtungen bestehen. Ricken selbst vertritt die Selbstzweckthese, d.h. Tiere sind für ihn in einem analogen Sinn objektive Zwecke oder Zwecke an sich selbst. Als Selbstzwecke sind sie daher niemals ausschließlich Mittel für die subjektiven Zwecke des Menschen. Damit ist in keiner Weise die Unantastbarkeit der Organismen behauptet, es wird lediglich eine Beweislast festgelegt, d.h. Eingriffe in das nichtmenschliche Leben bedürfen der Rechtfertigung. Der analoge Selbstzweckbegriff besagt, dass zwar alle objektiven Zwecke zu berücksichtigen sind, aber entsprechend ihrer Verschiedenheit unterschiedlich zu gewichten sind. Darauf ist später noch zurück zu kommen. Diese grundsätzlichen Überlegungen zum zweiten Element sind wohl mit den meisten Ansätzen der gegenwärtigen Tierethik dialogfähig zu halten. Das trifft zumeist nicht mehr zu, wenn nunmehr auch das erste und dritte Element integrativ mitbedacht werden. Nimmt man nur das erste Element hinzu, die kreatürliche Gemeinschaft alles Geschaffenen, dann ist theologisch sogar eine holistische Position, die jenseits jeglicher Hierarchisierung allem, was existiert, einen eigenständigen Wert und somit moralischen Status zuerkennt, vertretbar. Zum einen trifft es zu, das theologisch gesehen auch die nichtmenschliche Wirklichkeit moralisch relevant und demnach entsprechend zu berücksichtigen ist. Zum anderen ist zu bedenken, dass bereits biblisch diese kreatürliche Gemeinschaft in besonderer Weise zwischen Mensch und Tier verdeutlicht wird und darin implizit eine Rangordnung gegenüber der übrigen Schöpfung ausgesagt wird, die gleichfalls ernst zu nehmen ist. Nimmt man nur das dritte Element hinzu, die Sonderstellung des Menschen samt Herrschaftsauftrag, dann scheint theologisch nur eine anthropozentrische Position eingenommen werden zu können. Biblisch – so wurde gesagt – kann jedoch allenfalls von einer theozentrisch eingebetteten Anthropozentrik die Rede sein. Ist es daher überhaupt sinnvoll von einer Anthropozentrik zu sprechen, wenn man unter Berücksichtigung des ersten Elementes zudem bedenkt, dass dem Menschen nicht gegenüber, sondern inmitten dieser Schöpfung eine Sonderstellung zukommt? Der Begriff Anthropozentrik wird zumeist nur als Schlagwort, jenseits notwendiger Differenzierungen in den Diskurs eingebracht. Zu unterscheiden ist aber zumindest zwischen Formen
Methodische oder erkenntnistheoretische Anthropozentrik besagt, dass Erkennen und Verstehen unumgänglich anthropozentrisch sind. Sie artikuliert sich in der Einsicht, dass im Erkennen und Handeln der Mensch nicht eliminiert werden kann. Hierzu gehört auch, dass z.B. das vielfältige Bemühen im Rahmen pathozentrischer Ansätze, Tiere in die moralische Gemeinschaft zu integrieren, unumgänglich anthropozentrisch erfolgt, d.h. der Tieren zuerkannte moralische Status basiert letztlich auf Kriterien, die wesentlich durch den Grad der Ähnlichkeit zum „normalen“ erwachsenen Menschen bestimmt sind. Die moralische Integration von Tieren ist zentral von der „Reichweite unseres Einfühlungsvermögens“ (J.-C. Wolf 1992, 75) abhängig. Eine radikale oder neuzeitlich-positivistische Anthropozentrik betrachtet die nichtmenschliche Wirklichkeit primär als Objekt menschlicher Verfügungsgewalt, als ein vom Menschen zu analysierendes und beliebig manipulierbares Material. Mit ihr verbindet sich zugleich eine moralische Anthropozentrik, derzufolge nur Menschen ein moralischer Status zukommt, nichtmenschliche Lebewesen dagegen nicht moralisch relevant sind. Das hat wiederum einen radikalen Speziesismus zur Folge, wonach beliebige menschliche Interessen prinzipiell Vorrang vor denen der nichtmenschlichen Lebenswelt haben. Diese Form der Anthropozentrik wird dem Christentum oft vorgeworfen, wenngleich – zumindest sachlich gesehen - fälschlicherweise. Theologische Überlegungen können angemessen nur in einer relativen oder relationalen Anthropozentrik bedacht werden. Hierbei wird zwar an der Sonderstellung des Menschen festgehalten (= schöpfungstheologisches Element 3), zugleich werden aber die vielfältigen, stets auch in die nichtmenschliche Lebenswelt hineinreichenden Beziehungen, in welche Menschen konstitutiv eingebettet sind, konzeptiv integriert (= schöpfungstheologisches Element 1), und derart auch die nichtmenschliche Wirklichkeit in ihrem je eigenen Wert ernstgenommen und zu achten gefordert (= schöpfungstheologisches Element 2). Infolgedessen auch die nichtmenschliche Wirklichkeit moralisch relevant ist, bedürfen menschliche Eingriffe in diese der Rechtfertigung, was aber nicht die Unmöglichkeit einer solchen Rechtfertigung besagt. Vor dem Problem des Konflikts steht letztlich jede Moralbegründung. Eine relationale Anthropozentrik setzt somit voraus, dass der je eigene Wert der nichtmenschlichen Wirklichkeit zu berücksichtigen ist, aber entsprechend seiner Verschiedenheit unterschiedlich zu gewichten ist. Gemäß der Evolutionstheorie ist die Tierwelt höher als die Pflanzenwelt und das Leben überhaupt höher als die leblose Natur einzustufen. Zudem gilt es, die vielfältigen Unterschiede zwischen den Tieren selbst zu berücksichtigen. Die Ranghöhe eines Lebewesens innerhalb der scala naturae bestimmt den Grad der Berücksichtigungswürdigkeit des ihm zukommenden Eigenwerts. Zugleich wird in einer relationalen Anthropozentrik die Sonderstellung des Menschen und damit dessen Unterschied zum Tier aufrecht erhalten. Ich kann auf die schwierige Frage des (qualitativen sowie zum Teil auch fließenden und somit nur graduellen) Unterschiedes zwischen Mensch und Tier hier nicht näher eingehen. Ich sehe nur folgendes Grundproblem: Wird Gleichheit postuliert, dann werden (manche) Tiere auf die Ebene von Menschen gehoben und so die Menschen aus ihrer Sonderstellung heruntergeholt und gewissermaßen nur noch als „De-Luxe-Tiere“ (H. Halter) gesehen. Zugleich tritt hierbei aber das Bewußtsein radikaler Fremdheit und undurchdringlicher Andersheit, die auch zur menschlichen Tiererfahrung gehören, alsbald zurück und werden als vernachlässigbar angesehen. Das zentrale Problem liegt darin, beiden Aspekten gerecht zu werden, und die darin liegende Spannung auszuhalten und zu halten. Die Betonung der Ähnlichkeit verwischt oft die Differenz und die Betonung der Differenz verkennt zumeist die Ähnlichkeit. Auszugehen wäre vielmehr von einer Differenzgemeinschaft zwischen Mensch und Tier, d.h. in der Differenz ist zugleich die Gemeinschaft (und Ähnlichkeit) mit dem Tier und in der Gemeinschaft zugleich die Differenz zum Tier ernst zu nehmen. Zu beachten ist jedenfalls, dass aus Unterschieden des Menschen zum Tier nicht schon ein bestimmtes Verhalten und bestimmte Handlungen zum Tier abgeleitet werden können. Die Moralfähigkeit des Menschen zeichnet es gerade aus, einen Standpunkt einnehmen zu können, der nicht bloß die Sphäre menschlicher Interessen einbezieht. Wird die Differenzgemeinschaft zum Tier ernst genommen, dann ist ein ethisches Konzept herausgefordert, welches die unter Menschen und für Menschen entwickelte ethische Kultur, die vor allem auf gegenseitige Achtung und Minimierung jedweder Gewalt abzielt, in analoger Weise für unseren Umgang mit Tieren verbindlich macht. Vonnöten ist eine Weitung des Leitbilds der Humanität, das Tiere in ihrem jeweiligen Eigenwert auch direkt einbezieht. Eine Moral hingegen, die das Recht des Stärkeren als Prinzip etabliert, bezeugt und propagiert nicht Moralität, sondern Brutalität. Im Rahmen einer relationalen Anthropozentrik ist der Mensch verpflichtet, Tiere ihrem jeweiligen Eigenwert entsprechend zu behandeln. Die vorausgesetzte Sonderstellung des Menschen besagt daher keinesfalls, dass jedes beliebige menschliche Interesse Vorrang hat gegenüber tierlichen Interessen, vielmehr kommt den vitalen Interessen des Tieres Vorrang gegenüber weniger vitalen oder nicht-vitalen menschlichen Interessen zu. So sind z.B. ökonomische Interessen des Menschen kein moralisch zu rechtfertigender Grund für die industrialisierten Formen der Massentierhaltung. (Hier fehlt weithin auch der Aufschrei christlicher Kirchen oder wird nicht nachhaltig genug eingebracht ) Schwieriger erweist sich die Frage, wie der Konflikt zwischen gleichrangig zu bewertenden vitalen Interessen von Menschen und Tieren zu entscheiden ist? Aus christlich-theologischer Sicht bzw. im Rahmen einer relationalen Anthropozentrik kommt in einem solchen Fall den Interessen des Menschen Vorrang gegenüber den Tieren zu. Es wird also argumentativ die Position eines „schwachen Speziesismus“ (F. Riecken) bezogen. Diese Vorrangsregel rechtfertigt aber gerade kein beliebiges Verfügen über Tiere. Bei genauer Betrachtung würde sich wohl zeigen, dass in vielen Bereichen dem gegenwärtigen, weithin als selbstverständlich betrachteten Verfügen des Menschen über Tiere oftmals kein vitales menschliches Interesse gegenüber steht. Vitale Interessen des Menschen sind daher zumindest am Kriterium der Notwendigkeit zu prüfen. Nur wo die unumgängliche Notwendigkeit besteht, vitale Interessen von Tieren zu verletzen, um vitale Interessen des Menschen zu schützen und zu fördern, kann dies - unter Einbeziehung entsprechender Kriterien - moralisch gerechtfertigt werden. Was besagt das konkret. Es stellt sich – um ein zentrales Thema herauszugreifen – ohne Zweifel grundsätzlich die Frage, ob wir überhaupt das Recht haben, Tiere für Nahrungszwecke zu töten, insofern der Mensch auf solche Nahrung (in der Regel) nicht notwendig angewiesen ist. Die Antwort darauf wird - auch theologisch - wohl eher in Richtung eines Nein zu diskutieren und zu beantworten sein. Im Vorfeld wäre diese Frage zumindest dahingehend zu öffnen, dass die weithin übliche fraglose Selbstverständlichkeit des Fleischkonsums zugunsten einer fragwürdigen Notwendigkeit aufzugeben ist, zumal hiermit - wenigstens im Hinblick auf die gängige Massentierhaltung - auch ein sozialethisches Thema berührt wird, da bekanntlich die mit der sog. „Fleischproduktion“ verbundenen Energieverluste mitverantwortlich sind für den Hunger in vielen Ländern dieser Welt. Auch Tierversuche im Rahmen medizinischer Forschung, sofern sie überhaupt einen relevanten Erkenntnisgewinn ermöglichen, können nach dem Kriterium der Notwendigkeit allenfalls dann als ethisch legitim angesehen werden, wenn sie das einzige Mittel sind, um mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen erheblichen Erkenntniszugewinn zu erzielen und wenn das konkrete menschliche Interesse an einer Erweiterung des medizinischen Wissens in einem angemessenen Verhältnis zu den Einschränkungen und Leiden steht, die dafür den Versuchstieren auferlegt werden müssen. Auf zahlreiche Tierversuche treffen diese Kriterien nicht oder nur sehr bedingt zu und können daher ethisch nicht akzeptiert werden. Die letztgenannten Überlegungen stehen wohl am ehesten in Konflikt mit pathozentrischen Entwürfen einer Tierethik, obzwar sie moralisch weitaus restriktivere Urteile implizieren als dies gemeinhin mit einem sog. anthropozentrischen Ansatz verbunden wird. Eine relationale Anthropzentrik vermag zwar vielfältige pathozentrische Elemente zu integrieren, die zugrunde liegende Differenz zwischen Mensch und Tier unterscheidet sie aber von solchen Entwürfen, die jedoch hinsichtlich konkreter ethischer Konfliktfelder auch nicht zu einheitlichen Positionen gelangen. Diese Differenz ist zugleich maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Rede von Tierrechten weithin reserviert begegnet wird. Zwar wird nicht geleugnet, dass Tiere „irgendwie“ Rechte in bezug auf Menschen haben und es z.B. durchaus sinnvoll ist, in analoger Weise vom Recht der Tiere auf angemessene Ernährung und Pflege, auf verhaltensgerechte Unterbringung und einen artgemäßen Bewegungsraum zu sprechen. In diesem Sinn steht Tieren auch das Recht zu, keine schweren und unnötigen Schmerzen zugefügt zu bekommen. Höchst umstritten scheint hingegen die Frage, ob und gegebenenfalls wie Tiere Träger von (subjektiven) Rechten sein können. Eine befriedigende Antwort würde eine differenzierte Rechtstheorie voraussetzen. Zumeist wird kritisch darauf verwiesen, dass die Forderung von Tierrechten im Gegensatz zum überlieferten Verständnis und Begriff des Rechts steht, wenn nicht mehr der (herkömmliche) Begriff der Person als Voraussetzung für die Fähigkeit, Träger von Rechten zu sein, anerkannt wird. Die daraus resultierenden unübersehbaren Probleme lassen es daher angezeigt erscheinen, primär alles zu tun, die Stellung des Tieres im Recht adäquater einzubeziehen, anstatt für (oder gegen) Tierrechte Stellung zu beziehen. Ich komme zum Schluss: Die theologische Perspektive der Differenzgemeinschaft erfordert einen permanenten Balanceakt zwischen menschlicher Indienstnahme und Achtung tierlichen Lebens. Sie verbietet jede moralische Selbstzufriedenheit, vielmehr drängt sie zu erhöhter Verantwortung, die vor allem auf eine Minimierung der Gewalt gegenüber den Tieren drängt. Gerade das vierte Element des biblischen Schöpfungsglaubens, die geschichtlich fortdauernde und endgeschichtlich erhoffte Zusage Gottes, das vielfältige Leiden in der Schöpfung zu überwinden, ist wenigstens für ChristInnen jenes Motivationspotential, das Haltungen aus- und einprägt, die beständig dazu anspornen, die Beziehungen zwischen Mensch und Tier einer möglichst optimalen Gestaltung zuzuführen. Unumgänglich erweist sich die Haltung der Ehrfurcht, denn sie „ermutigt alles zu sich selbst“ (R. Guardini), mithin mutet sie eine Ethik zu, die dieser Ermutigung zu entsprechen vermag. |