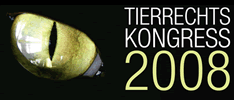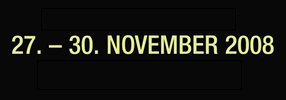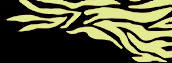|
„Der rechtsphilosphische Status von
Tieren“ von Prof. Dr. Eva-Maria Maier
I. Die Revision des (rechtlichen und moralischen) Tierstatus gehört
wohl zu den zentralen Zielsetzungen der aktuellen Tierrechtsbewegung
und findet ihren exemplarischen Ausdruck in der Reklamierung von
Grundrechten bzw des Personenstatus für Große Menschenaffen.
Ein rechtsphilosophischer Beitrag zur Korrektur der immer noch weitgehend
wirksamen Verdinglichung tierischer Lebewesen hat von der kritischen
Auseinandersetzung mit den philosophischen, rechtlichen und ökonomischen
Faktoren auszugehen, die den gesellschaftlichen Stellenwert von
(nicht menschlichen) Tieren weiterhin nachhaltig prägen.
II. Der Beitrag der philosophischen Tradition zum Status der Tiere
erweist sich dabei als bloßes „Nebenprodukt“ der
philosophischen Anthropologie und spiegelt über weite Strecken
wechselnde Akzentsetzungen im Nachdenken über den Menschen
wider. In tragisch-paradoxer Weise treiben vor allem die fortschreitende
Reflexion auf die spezifische freiheitliche Natur des Menschen und
die Durchsetzung modernen Menschenrechtsethos die Ausgrenzung und
Abwertung von Tieren sowie deren zunehmende Depotenzierung zu bloßen
Sachen voran.
III. In rechtlicher Hinsicht treten erste Ansätze einer Überwindung
des scheinbaren „Naturgesetzes“ modernen Privatrechts
einer abschließenden Einteilung in Menschen und „Sachen“
zu Tage (§§ 285a, 1332a ABGB), die auch durch entsprechende
Tendenzen im Strafrecht (§ 222 Abs.3) und insbesondere durch
die prinzipielle Ausrichtung des neuen TSchG auf den Schutz von
„Leben“ und „Wohlbefinden der Tiere“ unterstrichen
werden. Freilich lässt der konkrete Befund der Tierschutzrechtsreform
auf Grund weitreichender Ausnahmeregelungen, der bloßen Umsetzung
von EU-Mindeststandards in der Nutztierhaltung sowie der Installierung
von sehr unterschiedlichen Schutzniveaus bei Heim- und Nutztieren
letztlich nur geringe Fortschritte in der „Entdinglichung“
tierischer Lebewesen erkennen.
IV. Vor allem aber ist den modernen Formen hochindustrialisierter
Tiernutzung ein gewaltiger Qualitätssprung in der Instrumentalisierung
tierischer Lebewesen zuzurechnen, der auch eine radikale Veränderung
des traditionellen Mensch-Tier-Verhältnisses enthält.
Dabei verdrängt das unbegrenzte Streben nach Rationalisierung
und Nutzenoptimierung nicht nur die grundlegendsten Anforderungen
tierischer Bedürfnisbefriedigung, sondern lässt selbst
den ökonomischen Stellenwert des einzelnen Tiers – als
zu erhaltende Ressource – zurücktreten.
V. Als systematische Grundlage einer Tierethik und als kritisches
Korrektiv gegenüber massiven Auswüchsen der Instrumentalisierung
von Tieren wird der Rekurs auf die „Würde des Tieres“
als fundamentales rechtsethisches Grundprinzip vorgeschlagen - analog
und als notwendiges Gegenüber zur Menschenwürde. Der darin
geltend gemachte Eigenwert tierischer Lebewesen knüpft an naturwissenschaftliche
Fortschritte der Überwindung eines obsoleten „mechanistischen“
Tiermodells sowie an die Anerkennung grundlegender tierischer Interessen
an. In zentraler Weise gewinnt dieser Eigenwert freilich seine Grundlage
in der notwendigen fundamentalen Respektierung von Freude und Schmerz
tierischer Lebewesen als elementarer Erscheinungsformen subjektiver
Identität.
Konkrete institutionelle Konsequenzen daraus wären z.B. durch
die Verankerung einer Staatszielbestimmung Tierschutz, die Beseitigung
eklatanter Vollzugsdefizite im Tierschutz durch wirksame Kontrollmechanismen
und (weitere) Modelle der Vertretung tierischer Interessen bis hin
zur möglichen Einräumung „quasi-subjektiver“
Rechte für tierische Lebewesen zu ziehen.
|